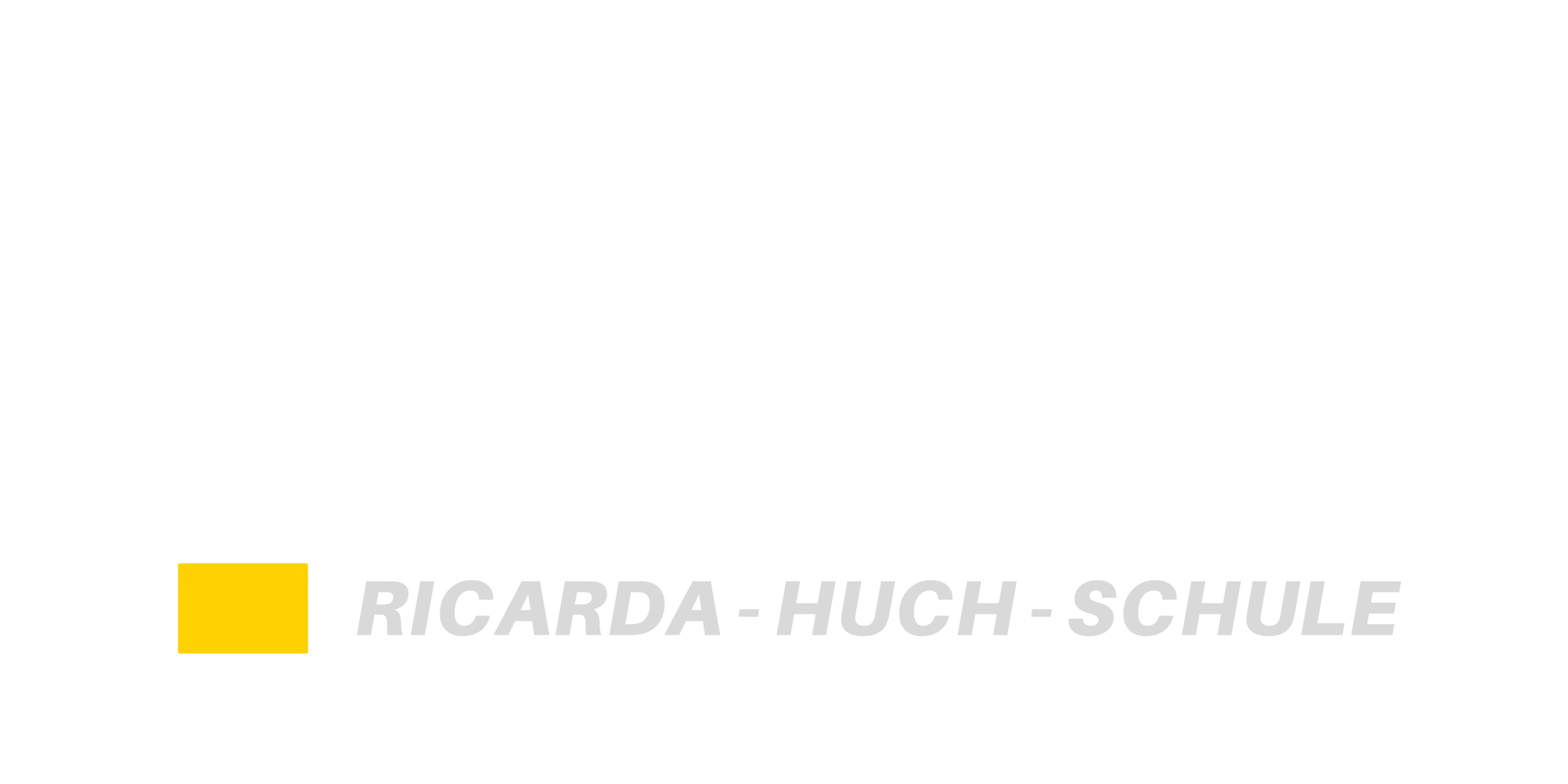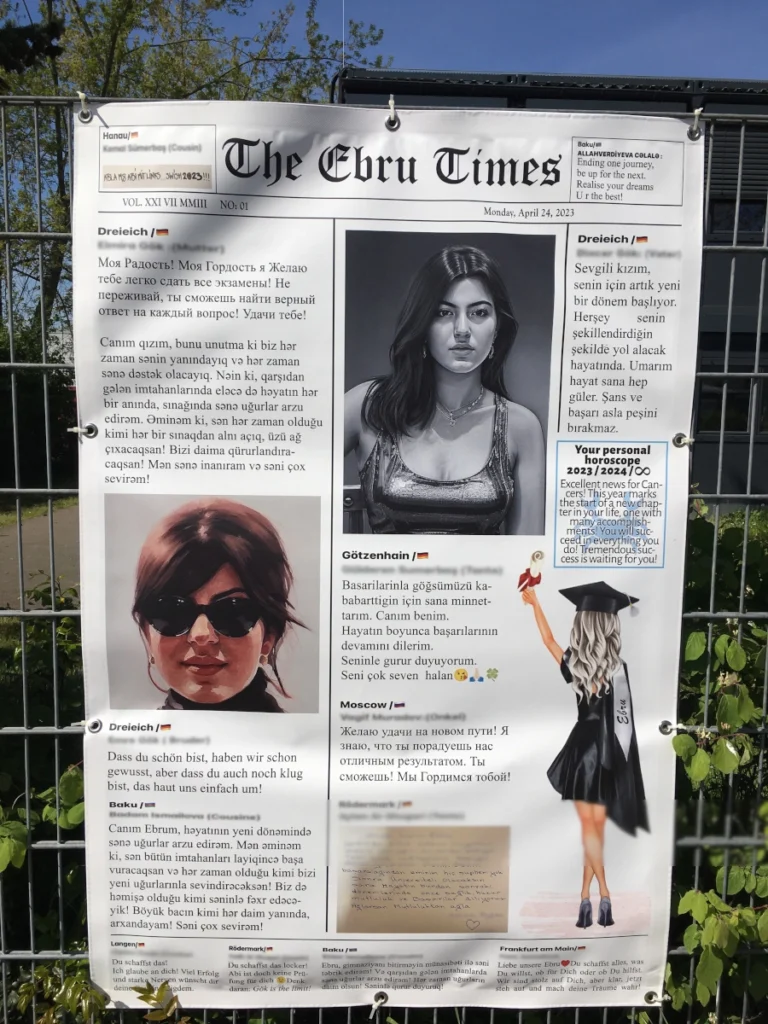Angehörige Überlebender des ehemaligen KZ Walldorf im Gespräch mit Oberstufenschülerinnen und -schülern der Ricarda-Huch-Schule

Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz und des 20jährigen Bestehens der Margit-Horváth-Stiftung hat diese erneut Angehörige Überlebender des ehemaligen Arbeitslagers Walldorf, eine Außenstelle des KZ Natzweiler-Strutthof, nach Walldorf eigeladen für ein umfangreiches Besuchsprogramm. Die Angehörigen reisten aus Ungarn als auch Israel an, um hier vor Ort die Geschichte des Lagers, die Erlebnisse der eigenen Familienangehörigen zu erfahren, zu recherchieren und sich miteinander auszutauschen. Unter den Besuchern waren Kinder, aber auch Enkel von Überlebenden des Lagers. Zum Großteil haben sie erst hier vor Ort viele Details über die konkreten Umstände und die Situation der inhaftierten Frauen und Mädchen, ihrer nahen Angehörigen, erfahren.

Das Lager in Walldorf war ein reines Arbeitslager, das dafür eingerichtet wurde, auf dem benachbarten, militärisch genutzten, Flughafen die erste betonierte Rollbahn zu errichten. Dies geschah unter den widrigsten Umständen und härtesten Arbeitsbedingungen. Das Lager war aber auch für die Bestrafung der Inhaftierten im Keller der Küchenbaracke bekannt, weshalb dieser in den letzten Jahrzehnten zum Teil ausgegraben und in das heute bestehende Margit-Horváth-Zentrum integriert wurde.
Am Freitag, den 24. Januar 2025 hatten Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe der Ricarda-Huch-Schule die Gelegenheit Irene und Ralph Stohn zu treffen, Tochter und Enkelsohn der Überlebenden Helén Katz. Sie waren extra aus Israel angereist, ihre Kenntnisse zur Geschichte ihrer Mutter und Großmutter haben sie vor allem den intensiven Recherchen von Ralph Stohn zu verdanken, der sich auf die Suche nach Dokumenten und Unterlagen gemacht hat. Die Mutter von Irene hat nicht über ihre Erlebnisse mit ihren Kindern gesprochen, sie merkten lediglich, dass es etwas gibt, dass die Familie stark beeinflusste, aber haben es nicht mit konkreten Berichten verbinden können. Helén Katz verstarb mit 55 Jahren, in einer Zeit, in der Irene selbst sehr beschäftigt war und somit haben sich keine Gelegenheiten ergeben, darüber zu reden. Dennoch ist Irene überzeugt davon, dass sowohl ihre Mutter als auch Vater ihre Kinder bestmöglichst beschützen wollten, indem sie schwiegen. In einen wirklich tiefgehenden Austausch über die Erlebnisse ihrer Mutter hier in Walldorf mit ihrem eigenen Sohn ist sie erst durch diesen Besuch vor Ort wirklich eingetreten. Es wird sicherlich noch länger dauern, alle neuen Erfahrungen und auch ingesamt alle Eindrücke zu verarbeiten.

Auch Ralph Stohn erzählte, dass er viele Aspekte erst in Walldorf selbst über das Lager erfahren habe. Seine durchgeführten Recherchen fanden auch durch Anregung seiner Frau statt, waren ebenso durch Zeiten geprägt, in denen er nicht weiter an den Dokumenten lesen und recherchieren konnte – es waren einfach zu viele Grausamkeiten, die sie erzählten. Angesprochen, wie er zur Firma Züblin stehe, die bis heute die historische Verantwortung nicht übernimmt, erzählt er der Gruppe, dass er selbst sogar mal im Laufe seines Berufslebens mit dieser Firma zusammengearbeitet habe. Dies habe er jedoch nicht gewusst. Aber es wäre auch nicht wirklich von Bedeutung für ihn, denn aus seiner Sicht ist es viel wichtiger die eigenen Familiengeschichte zu kennen und bei Lücken, diese durch Recherchen zu füllen. Damit ginge Erinnerungskultur einher, die von großer Bedeutung für die gesamte Familie und die eigenen Entscheidungen sind. Schließlich würde die Firma heute auch von anderen Menschen geführt als zu der Zeit, in der das Walldorfer Lager existierte. Die persönlichen Geschichten dürfen nicht vergessen werden, sie müssen wachgehalten werden. Junge Menschen müssen möglichst früh gelehrt werden, was Menschlichkeit, Vielfalt, Toleranz und Respekt bedeutet. Diese Werte müssen mit Leben gefüllt werden, im Miteinander zwischen Kulturen, Menschen und Völkern. Dafür sprechen sich nicht nur die Angehörigen selbst, sondern auch die Schülerinnen und Schüler deutlich aus.
Die Veranstaltung wurde von Sanja Jankovic, einer ehemaligen Schülerin unserer Schule und Mitorganisatorin dieser Besuchswoche, moderiert. Sie erzählte im Nachgang zur Veranstaltung, dass Irene ihr erzählt habe, dass sie das Interesse seitens der jungen Menschen förmlich habe spüren können. Sie selbst sei während ihrer Anfangsrede sehr nervös gewesen, aber es war so still, dass man eine fallende Nadel hätte hören können. Das Interesse der jungen Menschen habe sie tief gerührt und positiv überrascht. Dadurch habe sie sich so stark gefühlt wie noch nie zuvor und es ehre sie, dass die damit in die Fußstapfen ihrer Mutter treten könne. Ich denke allen Beteiligten ging es gleich, diese Begegnung wird allen lange in Erinnerung bleiben und hat alle nachhaltig berührt.
An dieser Stelle nochmals ein großer Dank an alle Kooperationspartner: der Margit-Horváth-Stiftung, der Stadtbücherei Dreieich-Sprendlingen und vor allem großen Dank an Sanja Jankovic!
(Verfasserin: Myriam Andres, 13.02.2025)